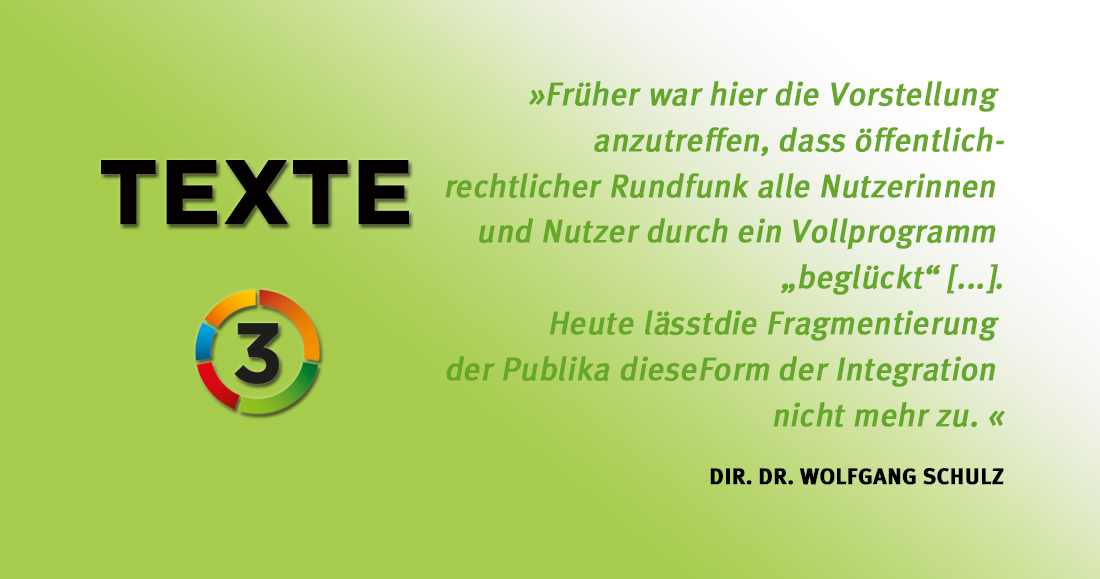[Eine Seite zurück]
»Wovon man spricht, das hat man nicht.«
Was man aus der deutschen Public-Value-Debatte über Qualität lernen kann
DIR. DR. WOLFGANG SCHULZ
HANS-BREDOW-INSTITUT HAMBURG
Wer in Deutschland in den letzten Jahren öffentliche Diskussionen zur Qualität im Fernsehen annonciert sah, tat gut daran, den in der Überschrift zitierten Ausspruch von Novalis zu erinnern und sich abzuwenden. Andernfalls konnte man etwa Zeuge von Gesprächen zwischen dem Literaturkritiker Reich-Ranicki und Moderator Thomas Gottschalk werden, die den geschundenen Gaul einer vermeintliche Differenz zwischen Qualität und Quote totritten und mit undifferenziertem und derbem Vokabular („blödsinnig“, „verblödet“) eher Freunde der Autologie bedienten.In der Diskussion um Qualität prägt sich das aus, was sich als „Strukturvorteil des Destruktiven“ bezeichnen lässt: Kritik ist von Natur aus differenziert, positive Erwartungen dagegen schwer strukturierbar. Ausgerechnet die Europäische Kommission und der deutsche Gesetzgeber haben nun der Qualitätsdiskussion in Deutschland eine Struktur gegeben. Das Beihilfeverfahren der Europäischen Kommission gegen die Finanzierung öffentlich-rechtlichen Rundfunks endete im Frühjahr 2007 mit einer Entscheidung, der ein Kompromiss zwischen der Bundesrepublik und der Kommission zugrunde liegt. Ein zentraler Gegenstand dieses Kompromisses war, dass in der Bundesrepublik zur Konkretisierung des Auftrages im Bereich der Telemedien (die deutsche Kategorie für die meisten Internet-basierten Dienste) durch einen Drei-Stufen-Test konkretisiert wird. Die Prüfungsmaßstäbe finden sich nun in § 11 f des Rundfunkstaatsvertrages und bilden so quasi den Maßstab für die deutsche Variante des „Public-Value-Tests“, nämlich:
1. Ein Angebot muss zum öffentlichen Auftrag gehören, d. h. den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen einer Gesellschaft entsprechen und
2. in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beitragen, außerdem muss
3. der Aufwand, der für die Erbringung des Angebots vorgesehen ist, transparent gemacht werden.
Sowohl für die erste Prüfungsstufe, aber auch für die Frage, inwieweit ein qualitativer Beitrag zum publizistischen Wettbewerb geleistet werden kann, wenn gegenständlich ähnliche private Angebote bereits existieren, benötigt das Testverfahren Kriterien. Indem der Gesetzgeber von gesellschaftlichen Bedürfnissen spricht und die abschließende Entscheidung über den „Public Value“ den Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland überlässt, die den Test durchführen, macht er auch deutlich, dass es sich dabei nicht um rein wissenschaftlich ableitbare, reliabel messbare Daten handelt, sondern es um wertbezogene Kriterien geht, deren abschließende Beurteilung eben den plural zusammengesetzten Gremien obliegt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass nichtempirische Grundlagen für die Entscheidung nützlich oder sogar erforderlich sind.
Die Qualitäten im Drei-Stufen-Test sind abzuheben von den journalistisch-redaktionellen, „handwerklichen“ Kriterien, die als Qualitätsmaßstäbe an alle Angebote angelegt werden können. Der Gesetzgeber knüpft in Nr. 1 explizit an bestimmte „Bedürfnisse der Gesellschaft“ an (die Formulierung entstammt dem sogenannten Amsterdamer Protokoll, einem Teil der EU-Verträge, der regelt, welche Spielräume die Mitgliedsstaaten bei der Gestaltung ihrer Ordnung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben): demokratische, soziale und kulturelle. Die drei Dimensionen lassen sich weiter aufschlüsseln, dies kann wiederum entlang unterschiedlicher Programm-Genres geschehen.
Nimmt man sich z. B. den Bereich Information vor und fragt nach dem demokratischen Wert, so besitzen hier etwa Angebote „Public Value“, die das Verständnis der Strukturen von Politik vermitteln sowie Orientierungswissen über aktuelle Politikbereiche und politische Entscheidungsverfahren zur Verfügung stellen. Dazu gehört etwa eine gewisse Perspektivenvielfalt, damit sich Nutzer ein ausgewogenes Bild über die jeweiligen Themen machen und eine eigene Position entwickeln können. Jedenfalls diskutabel erscheint, dass ein angemessener Anteil von „Hard News“ erforderlich ist, um politische Entwicklungen verfolgen zu können. Auch eine gewisse inhaltliche Durchdringungstiefe kann einen Wert eines Angebots erhöhen.
Betrachtet man die sozialen Bedürfnisse, so können sich hier Informationsangebote erheblich unterscheiden, etwa was die Alltagsrelevanz der ausgewählten Themen und die Verständlichkeit der Berichterstattung angeht. Es kann auch die Frage gestellt werden, ob der Fokus eher auf vermittelnde, lösungsorientierte Ansätze gerichtet wird oder die Polarisierung im Vordergrund steht. Schließlich kann im Hinblick auf den kulturellen Wert gefragt werden, inwieweit ein Angebot unterschiedlichen kulturellen Ausdrucksformen gerecht wird. Geht es um die Bewertung von Online-Angeboten, so wird ein Nutzen auch darin bestehen, die Internet-spezifischen Möglichkeiten im Hinblick auf die angesprochenen Werte einzubringen, also etwa Mechanismen, die Interaktivität ermöglichen, einzusetzen, um eine demokratische Partizipation zu befördern.
Das Vorgenannte sollte einen Eindruck vermitteln, in welche Richtung die Diskussion der Gremien verläuft, wenn es um die Durchführung des Drei-Stufen-Tests geht. Praktisch haben sowohl ARD als auch ZDF von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Rahmen der Prüfungen des Bestandes an Online-Angeboten Workshops zum Thema Qualität durchzuführen und sich mit aktuellen Differenzierungen in der Wissenschaft vertraut zu machen.
Der Test ist in Deutschland eingebettet in die allgemeinen Grundsätze zum Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der bisher nicht den Differenzierungsgrad hat wie die 18 Public-Value-Kriterien, die der ORF-Philosophie zugrunde liegen. Die Ausdifferenzierung der oben genannten Merkmale führt allerdings in eine vergleichbare Richtung.
So wird etwa in Deutschland wohl unter der Rubrik „sozialer Wert“ das einzuordnen sein, was in den Ursprüngen der Diskussion um die Funktion öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland als Integrationsfunktion“ beschrieben wurde. Früher war hier die Vorstellung anzutreffen, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk alle Nutzerinnen und Nutzer durch ein Vollprogramm „beglückt“ und so jedenfalls einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stellt.
Heute lässt die Fragmentierung der Publika diese Form der Integration nicht mehr zu. Dadurch aber verschärft sich das Problem, denn erste Befunde deuten in die Richtung, dass sich die gemeinsame öffentliche Agenda reduziert, wenn jeder Informationsbedürfnisse durch individuelle Suche im Online-Bereich befriedigt. Stimmt diese Annahme, so sollte es eine zentrale Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sein, zielgruppengerechte, aber aufeinander bezogene Kommunikationsangebote online zu machen, um gesellschaftliche Kohärenz zu erhalten.
Vor diesem Hintergrund ist auch der Gesellschaftswert „Integration“ im Public-Value-Konzept des ORF zu sehen. Ziel kann nicht Integration im Sinne des Schaffens einer homogenen Gemeinsamkeit sein, sondern es ist schon viel gewonnen, wenn ein gemeinsamer kommunikativer Rahmen entsteht, der Unterschiede als Differenzen innerhalb eines gemeinsamen Ganzen beschreibbar macht. Dies können Differenzen des Alters oder der Religionen, von Stadt und Land oder Rauchern und Nichtrauchern sein. Das Schaffen kommunikativer Übergänge wird in der „digitalen Gesellschaft“ – um den Namen einer vom Deutschen Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission aufzugreifen – eine zentrale Rolle gemeinwirtschaftlich finanzierter Kommunikationsangebote sein.
Werden solche Überlegungen auf konkrete Programmstrategien angewandt, dann ist nicht nur Qualitätsdiskurs und Qualität zusammen denkbar, der Qualitätsdiskurs wird zum Qualitätsmanagement.