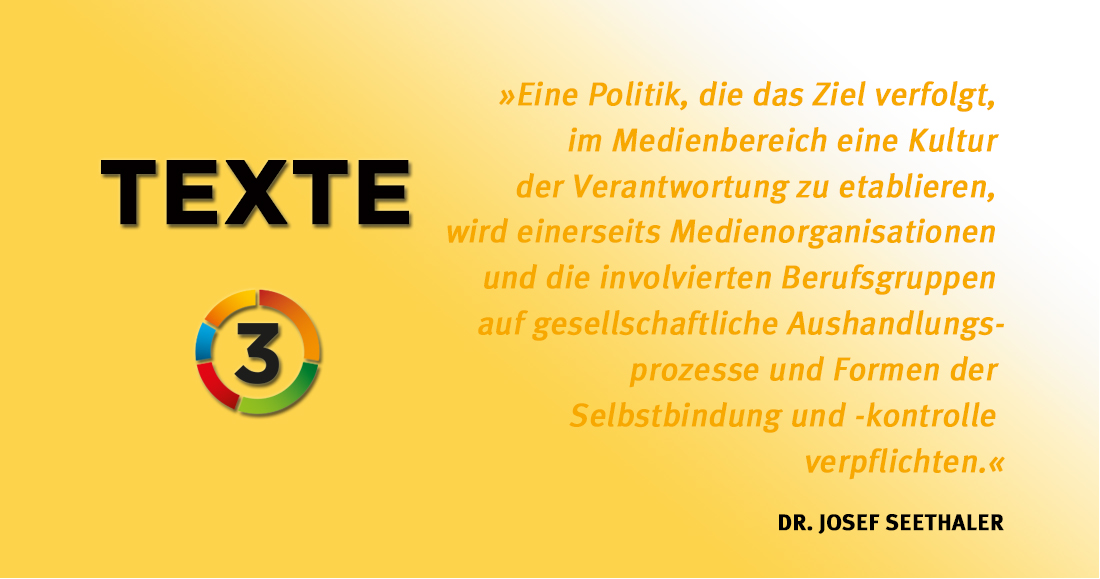[Eine Seite zurück]
Qualität darf nicht nur öffentlich-rechtlich sein
Dr. Josef Seethaler, Österreichische Akademie der Wissenschaften
DR. JOSEF SEETHALER
SENIOR SCIENTIST AN DER KOMMISSION FÜR VERGLEICHENDE MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG
DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
Nicht nur diese Schriftenreihe reflektiert Qualität in öffentlich-rechtlichen Medien. Auch in der mit Medienfragen befassten Wissenschaft und selbst in einer breiteren, kritischen Öffentlichkeit wird angesichts zunehmender ökonomischer Zwänge der Ruf nach einer Bestandssicherung für Qualitätsmedien immer lauter. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, für ein eigenes, von den Privatsendern unterscheidbares und die Gebührenfinanzierung rechtfertigendes Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sorgen, und für Qualitätszeitungen werden neue Finanzierungsmodelle zur Sicherung ihres wirtschaftlichen Überlebens (von einem eigenen Nationalfonds bis zu „Volksaktien“) diskutiert.Diese Forderungen sind nicht unberechtigt. Rasante technische Entwicklungen und (zum Teil) damit verbundene tiefgreifende Veränderungen der wirtschaftlichen Grundlagen der Medien, ihrer Organisation und Nutzung ließen die Medienmärkte in eine dramatische Situation schlittern, die von vielen als Krise beschrieben wird. Medienpolitik erschöpft sich jedoch allzu oft (und nicht nur hierzulande) darin, im weitgehend marktwirtschaftlich organisierten Printsektor jene Produkte offen oder versteckt zu subventionieren, die der Förderung nicht bedürfen, aber aufgrund ihrer weiten Verbreitung die politischen Akteure verlocken, einer wohlwollenden Berichterstattung ein wenig nachzuhelfen. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht die Politik ohnehin traditionsgemäß eine Plattform zur Vertretung der Interessen der jeweiligen Machthaber, die sie gerade angesichts des steigenden Konkurrenzdrucks in Nach-Monopolzeiten umso verzweifelter zu bewahren versucht. Die in den meisten mittel- und nordeuropäischen Staaten realisierte Form eines „politics in broadcasting system“, also des Einschlusses von politischen und gesellschaftlichen Kräften in die Kontrolle des Unternehmens, entspricht dem hier vorherrschenden korporatistischen Gesellschaftsmodell, birgt aber schon in der Konzeption trotz der in Redaktionsstatuten geregelten Autonomie ein mehr oder minder großes Einflusspotenzial in sich.
Dennoch: Eine Qualitätsdebatte, die auf Qualitätsmedien fokussiert, greift zu kurz.
Qualität ist ein nicht exklusives GutSelbst wenn es gelänge, der Qualitätspresse bescheidene Nischen zu verschaffen, in denen die Marktgesetze zumindest abgemildert sind, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zumindest dank Onlineangebote seinen Programmauftrag ohne Schielen nach der Quote für ein schrumpfendes Publikum erfüllen kann: Hätte Medienpolitik damit ihre Aufgabe erfüllt?
Die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ berichtete im August 2010 von steigenden Einschaltquoten der RTL-Dokusoap „Familien im Brennpunkt“, der ohnehin bereits erfolgreichsten Nachmittagssendung des deutschen Fernsehens. Die bewusst abstoßende Mischung von Fiktion und inszenierter Realität um immer extremere und abwegigere Charaktere gibt problembehaftete Laiendarsteller einer voyeuristischen Lächerlichkeit preis, treibt die Grenze des Zeigbaren nach unten und die Profite nach oben. Österreichische Boulevardzeitungen führen im selben Monat (wieder einmal) vor, wie viel ihnen Privatsphäre und Persönlichkeitsschutz wert sind, indem sie ein Facebook-Foto einer slowakischen Studentin als das Bildnis einer in Wien ermordeten angeblichen Prostituierten veröffentlichen. Dass es sich dabei um eine für die Betroffene folgenschwere Verwechslung handelte, fügt der Nichtachtung der Rechte auch eines toten Menschen nur noch eine weitere Facette unverantwortlichen Handelns hinzu.
In der Tat: Eine Qualitätsdebatte, die auf Qualitätsmedien fokussiert, greift zu kurz. In einer ausdifferenzierten Gesellschaft spielen die Medien in vielerlei Hinsicht eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zentrale Elemente des politischen und sozialen Lebens können ohne die Kommunikationsleistung der Medien gar nicht funktionieren. Unter dieser Perspektive kann es nicht allein um Qualitätsjournalismus für eine gesellschaftliche Elite gehen. Qualität ist ein nicht exklusives Gut. Es geht um die Gesamtgesellschaft. Es geht um die Qualität in allen Medien.
Zwei Zielorientierungen von MedienpolitikWenn immer in einer Diskussion gesellschaftliche Defizite thematisiert werden, kommt die Forderung nach einem entsprechenden schulischen Unterricht wie das Amen im Gebet. Natürlich gilt auch hier, dass die Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen von entscheidender Bedeutung für einen selbstverantwortlichen Umgang mit den die gesamte Umwelterfahrung prägenden Medien ist. Aber das soll hier (ausnahmsweise mal) nicht Thema sein. Hier geht es darum, was eine Medienpolitik, die partikuläre Parteiinteressen hintanstellt, für einen qualitätsvolleren Journalismus tun kann. Und sie kann viel tun.
Zwei Zielorientierungen sollen herausgegriffen werden: die Etablierung einer Verantwortungskultur und die Institutionalisierung journalistischer Ausbildung. Beide nehmen die gesellschaftliche Funktion der Medien ernst.
Media Governance als VerpflichtungDer Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in zahlreichen Auslegungen des Artikels 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention zur Freiheit der Meinungsäußerung (und zu der aus ihr abgeleiteten Pressefreiheit) mehrfach und unzweideutig den Medien die Erfüllung einer für eine liberale und pluralistische Demokratie zentralen „öffentlichen Aufgabe“ zuerkannt. Demnach ist es die Aufgabe der Medien – und zwar aller Medien und nicht nur der öffentlich-rechtlichen –,Informationen und Ideen über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu kommunizieren.
Der Europäische Gerichtshof geht sogar noch einen Schritt weiter. Er stellt dieser öffentlichen Aufgabe der Medien das Recht der Öffentlichkeit gegenüber, diese Informationen und Ideen zu erhalten. Dieses Recht der Öffentlichkeit begründet in besonderer Weise die Verpflichtung des Staates, die Medien in ihrer Funktion für die Öffentlichkeit zu schützen – auch vor dem Staat selbst. Es sind nicht zuletzt die Medien selbst, die (zu Recht) auf diese Verpflichtung pochen. Da der Staat daher bei Eingriffen in deren Tätigkeit Zurückhaltung üben sollte, um nicht in den Verdacht zu geraten, die Medienfreiheit beschränken zu wollen, bedarf es Regulierungsmodelle, die von den Beteiligten, den Produzenten und Konsumenten, getragen werden. Wer (und das gilt insbesondere für die Produzentenseite) die journalistische Leistung als Dienst an der Allgemeinheit interpretiert und von staatlicher Seite aus diesem Grund besonderen Schutz erwartet, der muss bereit sein, die Qualität dieser Leistung im Sinne der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe zu sichern.
Gefragt sind Modelle einer Media Governance. Im Unterschied zum traditionellen Government meint Governance die Regelung von Sachverhalten durch eine Vielzahl von Akteuren aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Sie zielt auf gemeinsam ausgehandelte Verfahrensregeln, durch die bestimmte Ziele im öffentlichen Interesse erreicht werden sollen.
An dieser Stelle mögen gelernte Österreicher/innen einwenden, dass im Publikumsrat des ORF ohnehin eine breite Palette gesellschaftlicher Akteure vertreten ist, die gewisse Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten beanspruchen können. Allerdings handelt es sich bei ihnen um durch den Staat ausgewählte, sogenannte „gesellschaftlich relevante“ Gruppen, an die die Vertretung der Interessen breiter (und über ihren legitimen Vertretungsanspruch hinausreichender) Bevölkerungsschichten delegiert wird. In ihrer überwiegenden Mehrzahl sind sie Teil der korporatistischen und elitistischen Politikstrukturen und daher parteipolitisch eindeutig zuordenbar. Zu Recht gehen privatwirtschaftlich organisierte Medienorganisationen auf Distanz zu solchen Modellen gesellschaftlicher Mitwirkung, die nicht Teil der Lösung, sondern eher Teil des Problems sind, weil sie die Angst vor staatlicher und letztlich parteipolitisch motivierter Einflussnahme schüren. So wird der Markt zum alleinigen Bezugspunkt, obwohl nicht kontrollierte Marktkräfte ebenso sehr die journalistische Autonomie beschneiden können. Es ist nicht weiter überraschend: Eine 2004 europaweit durchgeführte Untersuchung von Governance-Strukturen im Rundfunksektor reiht Österreich aufgrund seiner mehr formalen denn substanziellen Maßnahmen zur Sicherung von Publikumsbeteiligung und Transparenz in die Gruppe der „less advanced countries“ und signalisiert damit einen deutlichen Aufholbedarf gegenüber den meisten nord- und mitteleuropäischen Staaten, mit deren Mediensystemen Österreich vergleichbar ist.
Ein ähnliches Strukturproblem kennzeichnet den 2001 aufgelösten und jüngst irgendwie wiederbelebten Presserat. Gemäß sozialpartnerschaftlicher Logik zusammengesetzt, neigen die in ihm repräsentierten Organisationen per se dazu, die jeweiligen Standesinteressen zu vertreten und im Interesse der Aufrechterhaltung von Privilegien zu wirken.
Organisationsprinzipien, wie sie dem Presserat, aber auch dem Publikumsrat zugrunde liegen, sind, so der Kommunikationswissenschaftler Otfried Jarren, „nicht mehr zeitgemäß“ und „kaum dazu geeignet“, im Sinne jener Zielorientierung zu arbeiten, deren Realisierung angesichts der Krisensymptome dringender denn je ist: die Etablierung einer Verantwortungskultur.
Etablierung einer VerantwortungskulturGovernance-Modelle setzen auf das Selbstorganisationspotenzial einer Gesellschaft. Anstelle der bisher praktizierten Delegation von Verantwortung wird ein höheres Maß an Selbstverantwortung zum Ziel politischer Gestaltung. Eine Politik, die dieses Ziel verfolgt, versteht sich nicht bloß als Entscheidungszentrum, sondern als gesellschaftliches Moderations- und Kommunikationszentrum, das freilich durch seine de facto gegebene Entscheidungskompetenz Einfluss auf kollektiv bindende Entscheidungen nehmen kann.
Eine Politik, die das Ziel verfolgt, im Medienbereich eine Kultur der Verantwortung zu etablieren, wird einerseits Medienorganisationen und die involvierten Berufsgruppen auf gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und Formen der Selbstbindung und -kontrolle verpflichten. Dazu gehören Regelungen für die Durchsetzung ethischer und professioneller Standards genauso wie Regelungen für ein publizistisches Qualitätsmanagement, das sowohl transparent ist als auch trotz Berücksichtigung medienspezifischer Besonderheiten vergleichbare Evaluierungen erlaubt. Die Stiftung Medien & Gesellschaft mit Sitz in Genf hat erst vor kurzem eine gemeinsame internationale Norm für Rundfunkanstalten, Printmedien und Neue Medien vorgelegt, die die Anforderungen an ein solches Qualitätsmanagementsystem unter Weiterführung früherer ISO-Normen formuliert.
Eine an einer möglichst breit getragenen Verantwortungskultur interessierte Medienpolitik wird aber zugleich die Voraussetzungen schaffen, die es möglichst vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren, auch und nicht zuletzt jenen, die für vetoschwache Interessen stehen, ermöglichen, sich an den Aushandlungsprozessen von Normen und Regeln zu beteiligen. Entscheidend ist, dass dafür institutionalisierte Formen (wechselseitiger) Beobachtung und auf Dauer gestellter Kommunikation über diese Beobachtungen geschaffen werden, die als Voraussetzung wechselseitiger Beeinflussung und gemeinsamen Verhandelns gelten können. Öffentlichkeit ist ein essenzieller Bestandteil solcher Strukturen.
Eine vom früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker eingesetzte Kommission hatte bereits 1984 in ihrem Bericht „Zur Lage des Fernsehens“ konkrete Handlungsempfehlungen abgegeben, die, auf das Mediengesamtsystem ausgeweitet, nichts an ihrer Aktualität verloren haben. Demnach sollte in einem zweigleisigen Modell ein Medienrat u. a. strukturelle Entwicklungen auf den Medienmärkten analysieren, Maßstäbe der Medienverantwortung entwickeln und die Wahrnehmung von Verantwortung in den Medienorganisationen beobachten, während sich eine Stiftung Medientest um eine kontinuierliche und kritische Auswertung der Medienangebote bemühen und Materialien zur Konsumentenberatung bereitstellen sollte. Ergänzt um eine medienübergreifende Beschwerdeinstanz, zeichnen sich hier auf Systemebene durchaus umsetzbare Governance-Strukturen ab. Fraglos bedarf auch eine Beschwerdeinstanz in Medienangelegenheiten der Einbindung des Publikums, da ihre Spruchpraxis nie die Verbindlichkeit eines Gerichts erreichen kann (und soll) und sich außergerichtlich, wie die Analyse von Best-Practice-Modellen zeigt, effzienter Druck anders nicht organisieren lässt. Vorbilder für eine Beteiligung und ein direktes Mitspracherecht des Medienpublikums in verschiedenen Governance-Formen gibt es europaweit in großer Zahl; sie können hier nicht im Detail dargestellt werden.
Institutionalisierung journalistischer AusbildungQualität lässt sich nicht verordnen. Sie bedarf einer breit realisierten Verantwortungskultur, die eine ebenso verantwortungsbewusste Medienpolitik etablieren kann und muss – wenn notwendig, mit Hilfe ihres Drohpotenzials. Die einer solchen Verantwortungskultur zugrunde liegenden Governance-Formen lassen sich im Wesentlichen um vier Handlungsinstrumente gruppieren: Feedback, Evaluation, Monitoring – und Ausbildung. Würden die drei erstgenannten Instrumente in den oben genannten Formen ihre Realisierung finden, so sei hier das vierte Instrument extra hervorgehoben. „Den wichtigsten Beitrag zur präventiven Qualitätssicherung im Journalismus leistet fraglos eine gute Journalistenausbildung“, liest man bei Stephan Russ-Mohl, langjähriger Journalismusforscher, und Claude-Jean Bertrand sah in der Verbesserung der Ausbildung die „long-term solution to most problems of quality“. Für den international erfahrenen, 2007 verstorbenen Medienethiker war das „old-style on-the-job training“ seit jeher zwar praktisch, aber kurzsichtig. In Zeiten komplexer Auswirkungen der Globalisierung hielt er es jedoch für „dangerously insuffcient“.
Die Liste ähnlicher Stellungnahmen ließe sich endlos fortsetzen – und weit ins vorige Jahrhundert zurückverfolgen. Staatskanzler Karl Renner erachtete die Institutionalisierung der journalistischen Ausbildung für so wichtig und dringend, dass er 1919, nur wenige Monate nach der Gründung der österreichischen Republik, zu einer Enquete lud, die an der rechtswissenschaftlichen Fakultät verbindliche Kurse für das Pressewesen vorbereiten sollte. Die Initiative scheiterte an jenen, auf Talent und Praxis rekurrierenden Argumenten, die schon 1903 gegen die Gründung von Joseph Pulitzers „School of Journalism“ vorgebracht worden waren und die bis heute zur Zurückweisung von stärker institutionalisierten Formen dienen.
Aus Anlass des 65-jährigen Jubiläums der „Salzburger Nachrichten“ grenzte Chefredakteur Manfred Perterer professionellen Journalismus vom Civic Journalism in Blogs und Internetforen mit Hilfe eines Vergleichs ab. „Wer“, so schrieb er, „möchte in seinem Leben schon gern von einem Bürger-Zahnarzt behandelt oder einem Bürgerrechtsanwalt vertreten werden?“ Die (von Perterer nicht formulierte) Begründung für die plausible Antwort „Niemand“ liegt darin, dass Zahnärztin und Zahnarzt, Rechtsanwältin und Rechtsanwalt ihre Tätigkeit auf nachweislich erworbenem Wissen aufbauen und dieses Wissen essenziell für ihre Tätigkeit ist.
Es mag kein überzeugender Indikator für die Qualität des Journalismus sein, dass in den USA über drei Viertel der Journalistinnen und Journalisten ein einschlägiges Hochschulstudium absolviert haben, während in Österreich gerade ein Drittel einen akademischen Abschluss besitzt (wenn auch unter Frauen und jüngeren Berufsangehörigen die Akademisierung steigt). Es ist schon deshalb kein überzeugender Indikator, weil es nicht um irgendeinen Hochschulabschluss geht, sondern um den Erwerb spezifischen Wissens, und weil die Frage nach der Organisationsform der Ausbildungswege sekundär ist. Das Fehlen jeglicher allgemein verbindlicher journalistischer Ausbildungsstandards erschwert jedoch den Erwerb journalistischer Kompetenz, zu der theoretische Sachkompetenz und praktische Fachkompetenz ebenso gehören wie Vermittlungskompetenz, soziale Orientierung und in zunehmendem Maße Technik-, Gestaltungs- und Organisationskompetenz. Das Fehlen verbindlicher Standards gefährdet gerade in Zeiten des Umbruchs, wie der Vergleich Perterers illustriert, das Vertrauen in den Journalismus und die Autonomie des Journalismus. Es erleichtert die gegenwärtige Erosion arbeitsrechtlicher Standards, die ein Übriges zur Minderung der Qualität der Medienangebote beiträgt.
Es ist Zeit für einen Politikwechsel. Medienpolitik steht in der Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein qualitätsvolles Medienangebot fördern. Der ORF spielt (zumindest derzeit noch) eine wichtige Rolle im österreichischen Mediensystem, wenn auch eine andere als in Zeiten des Mainstream-Fernsehens. Es hat jedoch keinen Sinn, sich vorzumachen, dass der ORF alle Bürgerinnen und Bürger erreichen könne, wenn die Reichweite seiner Hauptnachrichtensendung im Jahresdurchschnitt unter 15 Prozent liegt. Bei aller Bedeutung der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen „Mehrwert“ kann man es nicht oft genug wiederholen: Es geht um die Qualität in den Medien. In allen Medien.